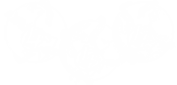Mehrere Bücher und Artikel haben in letzter Zeit eine sehr alte Debatte über die Entwicklung prähistorischer Gesellschaften wiederbelebt [1]. Wie anderen vor ihnen ist ihnen gemeinsam, dass sie die Ende des 19. Jahrhunderts entwickelte und von Engels in seinem Buch Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates (1884) aufgegriffene und wissenschaftlich untermauerte Vorstellung in Frage stellen, dass die Unterdrückung der Frau nicht immer bestanden hat.
Diese Akademiker behaupten im Gegenteil, dass die Herrschaft von Männern über Frauen seit mindestens dem Jungpaläolithikum, d. h. 30.000 oder 40.000 Jahre vor der Jungsteinzeit, das gemeinsame Los der menschlichen Gesellschaften ist. Nun ist die Jungsteinzeit, die je nach Weltregion vor 8.000 bis 12.000 Jahren einsetzte, für Marxisten eine Referenzperiode. So sind wir im Anschluss an Engels der Meinung, dass die Entwicklung der Produktivkräfte, die in dieser Periode stattfand, insbesondere die Speicherkapazitäten, der Ackerbau und die Viehzucht in großem Maßstab, die zur Vermehrung des Reichtums, zur Entstehung der sozialen Klassen, der Ausbeutung und des Staates führte, die materielle Grundlage für eine tiefgreifende Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse ist, deren eine Folge die systematische Einführung der männlichen Herrschaft und damit die Unterdrückung der Frauen war. Indem sie zu beweisen versuchen, dass die Unterdrückung der Frau mindestens seit dem Beginn des Jungpaläolithikums systematisch stattgefunden hat, stellen diese Wissenschaftler die Engelsche Argumentation und damit den Marxismus als Methode zum Verständnis von Gesellschaften, ihrer Entwicklung und der Art und Weise, wie man sie verändern kann, in Frage. Sie schließen sich damit denjenigen an, die behaupten, der Marxismus sei unfähig, die Vielfalt der prähistorischen Gesellschaften und ihre Entwicklungen zu erklären, und dass Blutsbande und Familienbande ausreichen, um alles zu erklären. Indem sie die Verbindung zwischen gesellschaftlichen Entwicklungen und der Unterdrückung der Frau unterbrechen, entziehen sie auch all jenen, die die Unterdrückung der Frau bekämpfen wollen, eine solide politische Grundlage, die besagt, dass durch ein Ende des Kapitalismus und der ausbeuterischen Gesellschaften auch die Unterdrückung der Frau wie jede andere Unterdrückung beendet werden kann. Sie schüren damit bewusst oder unbewusst zwei Ideen: entweder die alte, wiederbelebte reaktionäre Idee, dass Männerherrschaft das Los der menschlichen Gesellschaften praktisch seit Anbeginn der Menschheit ist und immer existieren wird, oder ihr falsch-radikales feministisches Pendant, das den Kampf gegen das Patriarchat zum übergeordneten Kampf erklärt und behauptet, dass der Versuch, die gesellschaftlichen Verhältnisse umzuwälzen, nichts bringt oder nur zweitrangig ist.
Die Aktualität des Ursprungs der Familie
Für das Verständnis der vorgeschichtlichen Gesellschaften, jener Gesellschaften, die definitionsgemäß keine schriftlichen Zeugnisse ihrer Organisation hinterlassen haben, können revolutionäre Aktivisten nur die Studien von Wissenschaftlern lesen. Engels machte es nicht anders, als er 1884 Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates veröffentlichte und sich dabei auf die anthropologischen Studien von Lewis Henry Morgan stützte. Diese Studien, die auf der Beobachtung der Irokesengesellschaft basierten, ließen annehmen, dass vor den in Klassen geteilten Gesellschaften Männer und Frauen in wirtschaftlich egalitären Gesellschaften - Engels sprach vom Urkommunismus - ohne Ausbeutung und ohne Staat organisiert waren, Gesellschaften, die Morgan als primitives Matriarchat bezeichnete, in denen, wie er behauptete, die Frauen dominierten. Sie machten deutlich, dass die moderne Familie, die Unterdrückung der Frau, die sozialen Klassen, das Privateigentum und der Staat keine Naturereignisse oder ewige Phänomene sind, sondern Produkte der menschlichen Geschichte und des Klassenkampfes.
Für Engels gab es kein Dogma. Wie er 1891 schrieb, war er bereit, seine Schrift zu überarbeiten, wenn sich die Literatur weiterentwickelte[2], was im 20. Jahrhundert der Fall war. Abgesehen von den von Engels in seinem Buch beschriebenen Etappen, die sich auf den Stand der Wissenschaft zu seiner Zeit stützten, liegt sein revolutionärer Aspekt in der Anwendung der marxistischen, historisch-materialistischen Argumentation auf das Verständnis dessen, was Gesellschaften sind. Diese Argumentation ermöglicht es zu verstehen, dass die Geschichte der Menschheit durch die Entwicklung der Produktivkräfte bestimmt wird, durch die Art und Weise, wie sich die Menschen organisieren, um zu produzieren und sich zu reproduzieren. Deshalb ist dieses Werk nach wie vor von bestechender Aktualität und bietet immer noch eine Grundlage für militante Aktivitäten, insbesondere im Verständnis, dass die kapitalistische Gesellschaft das Produkt einer Entwicklung ist, in seiner Analyse des Staates als Werkzeug der herrschenden Klasse und schließlich in den Mitteln zur Beendigung der Ausbeutung und aller Unterdrückung.
Im Bereich der Urgeschichte ist die Arbeit von Wissenschaftlern die Grundlage für den Erkenntnisfortschritt. Wissenschaftler existieren jedoch nicht über der Gesellschaft. Sie sind eines ihrer Produkte und ihre Argumentationen können die Einflüsse der jeweiligen Zeit widerspiegeln, umso mehr, wenn das Gebiet, das sie untersuchen, die menschlichen Gesellschaften betrifft.
Für einen dialektischen Materialismus
Seit Morgan hat die Anthropologie daher zahlreiche Denkrichtungen erlebt, die nicht nur dem Marxismus feindlich gesinnt waren, sondern auch die Idee in Frage stellten, dass sich die menschlichen Gesellschaften entwickelt haben. Ende des 20. Jahrhunderts wurde diese Idee der Entwicklung mit einer Strömung wiederbelebt, die in Frankreich von Alain Testart vertreten wurde, einem 2013 verstorbenen Anthropologen, der heute vielen Akademikern als Referenz dient. Für Testart hätten sich die vorgeschichtlichen Gesellschaften entwickelt, indem sie sich wie die Äste eines Baumes voneinander unterschieden - ein Bild, das die immense Vielfalt traditioneller Gesellschaften besser widerspiegelt, deren man sich im 20. Jahrhundert bewusst wurde. Testart lehnt jedoch den Marxismus als Methode zur Erklärung dieser Entwicklung ausdrücklich ab. Nach der materialistischen marxistischen Auffassung „ist die Produktion der Ideen, Vorstellungen, des Bewusstseins zunächst unmittelbar mit der materiellen Tätigkeit und dem materiellen Verkehr der Menschen, Sprache des wirklichen Lebens verflochten.“[3] Aber für Testart spielen zwar die technische Entwicklung, umweltbedingte und demografische Kausalitäten sowie die Beziehungen zu benachbarten Völkern eine offensichtliche Rolle, doch die Verwandtschaftsbande und die mit der Ehe verbundenen sozialen Verpflichtungen „reichen aus, um alles zu erklären - sie erklären bis hin zur Form der Wirtschaft“[4], ohne dass sie selbst durch die materiellen Bedingungen, unter denen die Menschen leben, oder durch ihre Geschichte erklärt werden müssen. So schlägt Testart vor, die langsame technische Entwicklung im Paläolithikum mit der Sozialstruktur der damaligen nomadischen Jäger und Sammler zu erklären, von der er annimmt, dass sie der der heutigen australischen Aborigines ähnelte[5], bei denen die Ehemänner, weil ihre Produktion von der Familie ihrer Frau, die aus einer anderen Gruppe der Gesellschaft stammt, vereinnahmt wird, keine Anreize haben, ihre Produktionstechniken zu verbessern. Während Testart oft eine materialistische Erklärung für die Entwicklung dieser oder jener Gesellschaft liefert, krönt er seine Argumentationen mit einem allgemeinen Prinzip - die Verwandtschaftsbeziehungen reichen aus, um alles zu erklären, einschließlich der Wirtschaft -, das ihn zu einer Position führt, die in der Philosophie als Idealismus bezeichnet wird, im Gegensatz zum Materialismus, da er die konkrete, soziale oder materielle Realität von der Vorstellung, die sich die Menschen von ihr machen, abgehen lässt.
Testart führt uns damit zu den alten bürgerlichen Vorstellungen zurück, die am Ende des 18. Jahrhunderts auftauchten und nach denen Ideen die Welt regieren. Allerdings entstanden Verwandtschaftsbeziehungen und Heiratsverpflichtungen nicht aus dem Nichts, sondern aus der Notwendigkeit, dass die ersten menschlichen Gesellschaften sich organisieren mussten, um auch nur die biologische Reproduktion der Gruppe zu gewährleisten, was die Grundlage der Wirtschaft ist. Ebenso können die Spenden- und Tauschsysteme in einer Reihe von Gesellschaften als Antwort auf die sowohl wirtschaftliche als auch soziale Notwendigkeit verstanden werden, Bindungen zwischen ihren Mitgliedern zu knüpfen, sie zu stärken, um ihren Fortbestand zu sichern und gleichzeitig ein gewisses Gleichgewicht bei der Verteilung der Ressourcen zu gewährleisten. Gegen diese umgekehrte Betrachtungsweise könnte man auch einwenden, dass soziale Strukturen wie die der Ureinwohner überall außer in Australien verschwunden sind, weil sie vielleicht ein Hindernis für die Entwicklung und den Einsatz neuer, effizienterer Techniken geworden sind, während die Strukturen der Gesellschaften, die sich damals entwickelten, es den Menschen ermöglichten, diese neuen Techniken voll zu nutzen. Die Beziehung zwischen der Wirtschaft und der Struktur der Gesellschaft (Staat, Recht, wenn es sie gibt, Bräuche, religiöse und mythologische Vorstellungen, Ideologie im Allgemeinen...) muss dialektisch und historisch verstanden werden, d. h. in ihrer Entwicklung und in den Widersprüchen aller Art, die ihre Triebfedern sind.
Um zu überleben, müssen die Menschen auf die Natur einwirken. Sie tun dies in Abhängigkeit von den Produktivkräften, über die sie verfügen, und den sozialen Organisationen, die sie aufgebaut haben und in denen sich die Techniken, die Arbeitsteilung und der Handel weiterentwickeln. Dieser ständige Wandel lässt innerhalb der Gesellschaften neue Widersprüche entstehen, die zu neuen Veränderungen, Weiterentwicklungen und Revolutionen führen, die wiederum Quellen für neue Entwicklungen sind. Jede Generation erhebt sich so auf den Schultern der vorherigen, baut ihre Welt aus den Bedingungen auf, die sie zum Leben und Wachsen gefunden hat, und indem sie ihrerseits so handelt, verändert sie ihr eigenes materielles, soziales und wirtschaftliches Umfeld, verändert sie sich selbst und die Generation, die ihr nachfolgen wird. Dass dies je nach Ort, Umständen und menschlichen Gruppierungen in unterschiedlichem Tempo angesichts der Geschichte der Menschheit geschieht und mehr oder weniger wahrnehmbar für einen heutigen Beobachter ist, und auch von einer Gruppe zur anderen unterschiedliche Ergebnisse hervorbringt, ist dennoch eine unbestreitbare Tatsache.
Für Alain Testart jedoch „ist es nicht nötig, einen Mechanismus zu entwerfen, um die Entwicklung der Gesellschaften zu denken“, „menschliches Handeln (des Menschen in der Gesellschaft, der auf die Gesellschaft einwirkt) ist eine notwendige und hinreichende Bedingung für die Entwicklung der Gesellschaften.“[6]Dass menschliches Handeln notwendig und hinreichend ist, ist eine Selbstverständlichkeit. Gesellschaften entwickeln sich, weil Menschen sie entwickeln, und zwar auf der Grundlage dessen, was sie denken. Allerdings muss man feststellen, welche Ideen in ihren Gehirnen auftauchen. Diese Ideen können sie nur in Abhängigkeit von ihrem Platz in der Gesellschaft, ihren Beziehungen zu anderen, ihrer technischen und demografischen Umgebung und auch von der Geschichte und der Kultur, die sie sich aufgebaut haben, bilden. Die sozialen Strukturen, die Verwandtschaftsbeziehungen sind nur ein Teil des Bildes.
Ausgehend von dem, was wir über die letzten 50.000 Jahre wissen, lässt sich feststellen, dass die globale Entwicklung der menschlichen Gesellschaften, abgesehen von den besonderen Entwicklungen in den einzelnen Gesellschaften, grundsätzlich durch die Entwicklung der Produktivkräfte und die Entwicklung der Techniken, die Männer und Frauen anwenden, erklärt werden kann. Fast alle Jäger- und Sammlergesellschaften, die den Planeten im Jungpaläolithikum bewohnten, wurden schließlich von Gesellschaften abgelöst, die Ackerbau und Viehzucht in großem Maßstab betrieben, außer an einigen Orten, an denen dies nicht möglich war (Wüsten, Eisschollen). Die Entstehung eines ständigen gesellschaftlichen Mehrprodukts und die stärkere Arbeitsteilung führten zu Umwälzungen in den sozialen Organisationen, den menschlichen Beziehungen und den Verwandtschaftsverhältnissen. Doch diesem Neolithikum, dieser ersten wirtschaftlichen Revolution, die sich über Jahrtausende erstreckte, folgten noch viele weitere, die letztendlich zu den modernen Industriegesellschaften führten. Diese globale historische Entwicklung, die durch die Entwicklung der Produktivkräfte bestimmt wurde, vollzog sich durch eine Vielzahl von Gesellschaften mit besonderen historischen Verläufen, die sich aus Gründen, die in jedem Fall im Detail zu analysieren wären, voneinander trennten oder sich miteinander verflochten, sich durchsetzten oder verschwanden und jeder betrachteten Gesellschaft ihren eigenen Charakter verliehen.
Die Vielfalt der Gesellschaften in der Vorgeschichte
In seinem 2020 erschienenen Buch Et l'évolution créa la femme kritisiert Pascal Picq, der sich weitgehend auf Alain Testart stützt, ebenfalls mehrfach den Marxismus, indem er die Verbindung zwischen Wirtschaft und sozialer Organisation in Frage stellt. So schreibt er: „Die Erkenntnisse lehnen den naiven und ideologischen sozialen Evolutionismus und vor allem den noch immer vorherrschenden Determinismus zwischen Wirtschaftssystem und sozialer Organisation ab, der vom marxistischen Denken geerbt wurde. Letzteres behält seine Bedeutung. Aber es ist klar ersichtlich, dass sich die sozialen Systeme bei denselben Volkswirtschaften und Produktionsmitteln erheblich voneinander unterscheiden, und dies gilt umso mehr für die Stellung der Frau.“ Pascal Picq lässt den Marxismus sagen, dass einem bestimmten technologischen Niveau ein einziger Gesellschaftstyp entspricht. Damit betrachtet er den Marxismus als verknöcherten, mechanischen und nicht dialektischen Materialismus, was vielleicht eine Folge der Schäden ist, die der Stalinismus im Bereich des wissenschaftlichen Denkens angerichtet hat, welches er prägte und den dialektischen Materialismus durch eine Scholastik ersetzte, die versuchte, die Realität so zu verbiegen, dass sie in vordefinierte Schubladen passte.
In Wirklichkeit ist die Kritik von Testart, Picq und einigen anderen nichts Neues oder Originelles. Es handelt sich um eine alte Debatte, die Marx selbst geführt hatte. 1845 schrieb er: „Auf jeder Stufe findet sich ein materielles Resultat, eine Summe von Produktionskräften, ein historisch geschaffnes Verhältnis zur Natur und der Individuen zueinander vor, die jeder Generation von ihrer Vorgängerin überliefert wird, eine Masse von Produktivkräften, Kapitalien und Umständen, die zwar einerseits von der neuen Generation modifiziert wird, ihr aber auch andrerseits ihre eignen Lebensbedingungen vorschreibt und ihr eine bestimmte Entwicklung, einen speziellen Charakter gibt“. [7] Die Menschen handeln, entwickeln ihre Techniken, verändern ihre sozialen Beziehungen wie die Beziehungen, die sie außerhalb ihrer Gruppe haben, mit einem Wort, sie verändern ihre Gesellschaft, während sie von ihr bedingt werden, d.h. von den Beziehungen, die sie eingehen und untereinander unterhalten.
Auch Georgi Plechanow, dem die Aufgabe zufiel, den Marxismus in Russland einzuführen, diskutierte das grundlegend Dialektische an der marxistischen Auffassung der Entwicklung menschlicher Gesellschaften, insbesondere in den Beziehungen zeitgenössischer Gesellschaften untereinander, dem „historischen Milieu“. Er behauptete 1895: „Der Clan ist eine Art von Gemeinschaft, die allen menschlichen Gesellschaften auf einer bestimmten Stufe ihrer Entwicklung eigen ist. Aber der Einfluss des historischen Umfelds unterscheidet das Schicksal der Clans in den verschiedenen Stämmen stark. Er verleiht ihnen sozusagen individuelle Züge. Er verlangsamt oder beschleunigt ihre Auflösung“.[8] Das bedeutet, dass die prähistorischen Gesellschaften, die eine lange Geschichte haben, selbst ein Produkt der Geschichte sind.
Der Einfluss des historischen Prozesses auf die Differenzierung von Gesellschaften ist eine Selbstverständlichkeit, auch wenn man die modernen kapitalistischen Gesellschaften, die sowohl gemeinsame als auch unterschiedliche Züge aufweisen, auch nur ansatzweise beobachtet. Die gleiche Produktionsweise wird aufgrund der besonderen Geschichte jedes Landes in Verbindung mit anderen Ländern unterschiedlich ausgestaltet, was Trotzki als ungleiche und kombinierte Entwicklung bezeichnete, die die Geschichte der Gesellschaften nicht zu unabhängigen linearen Geschichten, sondern zu einer verflochtenen Geschichte macht, wobei jede Gesellschaft sowohl aufgrund der Dynamik ihrer eigenen Widersprüche als auch unter dem Einfluss ihrer Nachbarn, ihrer eigenen Widersprüche sowie, auf einer anderen Ebene, der allgemeinen Widersprüche der Produktionsweise, die sie gemeinsam haben, voranschreitet.
Die Jungsteinzeit, ein grundlegender Wandel
Zu Beginn des Jungpaläolithikums, das in Anlehnung an die damals verwendeten Steinwerkzeuge wörtlich als Altsteinzeit bezeichnet wird, bevölkerten noch mehrere Menschenarten die Erde. Nur Homo Sapiens überstand diese Zeit und hatte die anderen Arten assimiliert und/oder verdrängt. In diesen Gesellschaften des Jungpaläolithikums waren die Produktivkräfte noch so wenig entwickelt, dass es weder Ausbeutung noch eine Einteilung der Gesellschaft in Klassen geben konnte. Der Zusammenhalt dieser Gesellschaften wurde nicht durch einen Staat gewährleistet, eine besondere öffentliche Autorität, die sich ihren Mitgliedern aufdrängte und von diesen abgeschnitten war. Diese Gesellschaften verwalteten sich selbst und konnten nur auf der Grundlage von Kooperation funktionieren. Eines der ersten Probleme der primitivsten Gesellschaften bestand darin, das Überleben der Gruppe und ihre Reproduktion zu sichern, was auf die eine oder andere Weise die Frauen in den Mittelpunkt der Gesellschaft stellte und nicht systematisch zu ihrer Unterdrückung führen konnte, was durch eine Reihe von ethnologischen Beobachtungen bestätigt wurde. Bei einem relativ geringen Entwicklungsgrad der Produktivkräfte und mit der Gemeinsamkeit, dass die Arbeit anderer nicht ausgebeutet wurde, konnten die Menschen in sehr unterschiedlichen Situationen und aus Gründen, die im Einzelnen analysiert werden müssten, sehr unterschiedliche soziale Strukturen und Kulturen aufbauen, die innerhalb derselben Periode des Paläolithikums ihrerseits bestimmte Entwicklungsmöglichkeiten eröffneten, die andere nicht zuließen. Dasselbe Verfahren des Brennens wird im Jungpaläolithikum zu Statuetten führen und einige Jahrtausende später zu Gefäßen, die eine Lagerung ermöglichen.
Die Jungsteinzeit, wörtlich das Zeitalter des jüngeren Steins, den man früher als geschliffenen Stein bezeichnete, erstreckte sich über mehrere Jahrtausende, eine Zeit, in der die Menschen lernten, Nahrung zu lagern, und einige sesshaft wurden. Die Gärten, die es wahrscheinlich am Ende des Paläolithikums in einigen Gesellschaften gab - man spricht von Gartenbaugesellschaften - wurden durch bewässerte Felder ersetzt, deren Erde von Pflügen gespalten wurde... Die Arbeitsteilung nahm zu, wurde zu einem allgemeinen Phänomen und nicht mehr nur zu einer Randerscheinung oder einem punktuellen Phänomen. Der Produktionsüberschuss, der durch die neuen Techniken ermöglicht wurde, erlaubte es Menschengruppen innerhalb dieser Gesellschaften, sich von der Nahrungsmittelproduktion zu befreien. Sie wurde zum Gegenstand des Kampfes zwischen den entstehenden gegensätzlichen sozialen Klassen. Die Hauptfunktion des Staates bestand darin, in Gesellschaften mit immer heftigeren Widersprüchen ein gewisses Gleichgewicht aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die Interessen der herrschenden und besitzenden Gesellschaftsschichten zu schützen.
In dieser Vorgeschichte, von den Anfängen des Jungpaläolithikums bis zur Jungsteinzeit, folgten etwa 1.500 Generationen von Männern und Frauen aufeinander, die sich in Tausenden von Gesellschaften organisierten, die eine sehr unterschiedliche Entwicklungsdynamik hinsichtlich ihres Tempos und der Grade, die sie erreichten, aufwiesen, die alle auf praktisch dem gesamten Planeten, in allen Umgebungen und unter allen möglichen materiellen Bedingungen besondere Entwicklungen durchliefen.
Wenn man die sogenannten traditionellen Völker beobachtet, diese Hunderte [9] von staatenlosen Völkern, die bis heute überlebt haben oder in den letzten zwei oder drei Jahrhunderten beobachtet wurden, weiß man, dass es sich dabei um Gesellschaften von Jägern und Sammlern, Nomaden, Halbsesshaften oder Sesshaften handeln konnte, Gesellschaften, die in unterschiedlichem Maße Gartenbau betrieben, mit oder ohne Reichtum, mit oder ohne Eigentum, das nicht auf der Nutzung beruhte. Sklaverei gab es nur in einigen dieser staatenlosen Gesellschaften, die eine sehr spezielle Wirtschaft hatten. In diesen staatenlosen Gesellschaften werden mindestens drei politische Systeme unterschieden: das System, in dem die Autorität auf Anerkennung, Einfluss oder Reichtum beruht, das System der primitiven Demokratie, das auf Räten beruht, wie bei den von Morgan beschriebenen Irokesen, und das System der sogenannten Abstammungs-Organisation, bei der die Macht dem ältesten Individuum in der Abstammung übertragen wird, in patrilinearer oder matrilinearer Erbfolge.
Die Vielfalt der vorgesellschaftlichen Gesellschaften ist in Wirklichkeit viel größer, denn man müsste all jene berücksichtigen - die überwiegende Mehrheit -, die verschwanden, ohne Spuren zu hinterlassen, weder schriftliche natürlich noch archäologische, die man nicht detailliert beschreiben kann, weil sie mit anderen verschmolzen oder weil sie sich zu moderneren Gesellschaften entwickelten, die die Staaten erfanden und die Menschheit in die eigentliche Geschichte eintreten ließen. Die von Ethnologen beobachteten Gesellschaften sind diejenigen, deren Entwicklung nicht diesen Weg genommen hat, weil das Milieu, in dem sie existieren, dies nicht notwendig oder nicht möglich gemacht hat. Und wiederum sind die, die man heute beobachten kann, diejenigen, die den Schub der modernen, kapitalistischen Gesellschaften, ihres Kolonialismus und Imperialismus überlebt haben. Sie konnten diesen Schub nicht überleben, ohne sich weiterzuentwickeln.
Nein, die Unterdrückung der Frau hat nicht immer existiert!
In Bezug auf die Beziehungen zwischen Männern und Frauen behaupten viele Wissenschaftler heute, dass es keine Hinweise darauf gibt, dass die menschlichen Gesellschaften zuerst in Form eines primitiven Matriarchats existierten, in dem die Frauen die gesamte Gemeinschaft beherrschten und die Machthebel in der Hand hielten. Ein solches Matriarchat ist in keiner von Ethnologen beobachteten Gesellschaft zu finden, und es gibt auch keine archäologischen Hinweise darauf. Auch Engels sprach nicht von einem Matriarchat. Aber die Tatsache, dass Frauen nicht herrschen, bedeutet nicht, dass sie unterdrückt werden. So schränkt Heide Goettner-Abendroth in ihrem Buch Les sociéts matriarcales [10] die Bedeutung des Wortes Matriarchat ein, indem sie sagt, dass die von ihr beschriebenen Gesellschaften keine Gesellschaften sind, in denen die Frauen die Männer beherrschen, ein umgekehrtes Patriarchat, sondern egalitäre Gesellschaften, auch zwischen den Geschlechtern, die um die Frauen herum organisiert sind.
Was die sexuelle Arbeitsteilung betrifft, das heißt die Aufteilung der für das Überleben der Gruppe notwendigen Aufgaben zwischen den Geschlechtern, so scheint diese in fast allen beobachteten sogenannten traditionellen Gesellschaften üblich zu sein, einschließlich der egalitärsten Jäger und Sammler, einschließlich der von Heide Goettner-Abendroth beschriebenen Gartenbaugesellschaften. Dies führt zu der Annahme, wie Engels bereits in Der Ursprung der Familie festgestellt hatte, dass eine solche Aufteilung wahrscheinlich schon vor dem Neolithikum elementar vorhanden gewesen sein muss.
Die Existenz der sexuellen Arbeitsteilung und das Fehlen von Gesellschaften, die ausschließlich von Frauen beherrscht werden, haben Wissenschaftler dazu veranlasst, nach primitiven Gesellschaften zu suchen, die keine sozialen Klassen kennen, in denen Frauen unterdrückt werden. Sie sind der Ansicht, dass sie diese in großer Zahl gefunden haben und dass es sich dabei um „irreduzible und unbestreitbare Tatsachen“ handelt. Viele dieser Beobachtungen werden von anderen Wissenschaftlern bestritten. Doch abgesehen von den Kontroversen unter Fachleuten sind es die Interpretationen, die einige von ihnen vornehmen, und die Schlussfolgerungen, die sie daraus ziehen, die wir als durch den Druck der Zeit befleckt betrachten.
Ihrer Meinung nach ist die männliche Dominanz ein gemeinsames Merkmal der prähistorischen Gesellschaften und damit aller bekannten Gesellschaften, die bis dahin existiert haben. Sie ziehen diese Schlussfolgerung aus ihren Beobachtungen, trotz aller Vielfalt der sozialen Organisationen prähistorischer Gesellschaften, trotz gegenteiliger Beobachtungen und Auslegungen, trotz der Jahrtausende, die vergangen sind, trotz der Tausenden von Gesellschaften, die spurlos verschwunden sind. Sie führen, bewusst oder unbewusst, aber durch die Hintertür, die „menschliche Natur“ wieder ein oder machen zumindest diese Unterdrückung zu einem unveränderlichen Merkmal der menschlichen Gesellschaften, als ob diese in dieser Hinsicht keine Geschichte hätten. Die Verteidiger des Strukturalismus, in der Mitte des 20. Jahrhundert, die in der Nachfolge von Claude Lévi-Strauss versuchten, nur die „Struktur“ der Gesellschaften anhand invarianter Merkmale zu untersuchen, leugneten durch ihre Entscheidung für „geschichtslose“ Gesellschaften bereits de facto, dass die Geschichte einen Sinn hat und dass dieser die Menschheit zu der Möglichkeit führt, die Klassengesellschaft loszuwerden und somit das kapitalistische System zu stürzen. Pascal Picq nimmt die Lebensweise der Menschenaffen als Referenz und kommt trotz einiger üblicher Vorsichtsmaßnahmen zu dem Schluss, dass „alle Daten der Ethologie [das Studium des Tierverhaltens] wie auch der Ethnografie zu Gesellschaften neigen, die von der Gewalt der Männchen und der Nötigung der Frauen beherrscht werden“. Er stellt die männliche Dominanz sogar als eine Konstante in der Geschichte der prähistorischen Gesellschaften dar, allerdings mit graduellen Unterschieden, entweder mit „zunehmend gewalttätigen Gesellschaften, insbesondere gegen Frauen“ oder mit „einer Verschärfung der Gewalt gegen Ende der Vorgeschichte“. In seiner Beweisführung ist er dennoch vorsichtig, denn er räumt nicht nur ein, dass Ethnologen die Dinge durch die Brille sehen, die ihnen die Gesellschaft auf die Nase gesetzt hat, mit ihren eigenen Vorurteilen, sondern er muss auch die vielen „Ausnahmen“ berücksichtigen, die in allen Arten von sogenannten traditionellen Gesellschaften zu beobachten sind. Schließlich werden Frauen zwar in einer Reihe von Gesellschaften, seien es Jäger und Sammler oder Gartenbaugesellschaften, verachtet, gewissermaßen unsichtbar gemacht, vergewaltigt oder haben nur sehr wenig Macht, doch ist dies keineswegs systematisch der Fall. Wenn Pascal Picq also schreibt: „Der Raum der gesellschaftlichen Möglichkeiten spielt sich nicht zwischen Gesellschaften ab, die von Frauen/Matriarchat oder Männern/Patriarchat beherrscht werden, vielmehr geht es von einer Situation der Gleichheit zwischen Frauen und Männern zu immer stärker ausgeprägten Ungleichheiten, bis hin zu sehr zwanghaften Formen des sozialen Antagonismus“, fasst er den Stand der Forschungen und Studien der Wissenschaftler der Vorgeschichte zusammen. Wenn er denselben Satz jedoch mit den Worten schließt: „Da alle diese Gesellschaften von Männern dominiert werden“, trifft er eine nicht ethnologische, sondern in Wirklichkeit politische, ideologische Entscheidung, die Dinge unter dem Blickwinkel der invarianten Dominanz der Männer darzustellen. Diese Haltung entspricht einigen aktuellen ideologischen Tendenzen, die das Patriarchat zum Ziel aller Kämpfe machen und sich dafür entscheiden, die Notwendigkeit zu ignorieren, das kapitalistische System zu stürzen, um die Unterdrückung der Frauen beenden zu können.
Die Unterdrückung der Frauen in den so genannten traditionellen Gesellschaften kann man übrigens nicht mit der Vorstellung beurteilen, die wir heute davon haben. In den Gesellschaften, die Ethnologen beschrieben haben, scheinen die Tätigkeitsbereiche von Männern und Frauen oft stark voneinander getrennt zu sein, sich aber zu ergänzen, wobei die Männer die Sphären der Politik, der Beziehungen zu anderen Gruppen, seien sie friedlich oder kriegerisch, an sich reißen und die Frauen echte Macht bei der Nahrungsproduktion haben. Zweifellos wurden diese Unterschiede mit dem Aufkommen des gelagerten und angehäuften Reichtums zu Beginn der Jungsteinzeit, noch mehr mit dem Aufkommen der sozialen Klassen und der Ausbeutung der Arbeit anderer, als Außenbeziehungen, Krieg und Handel für die Entwicklung der Gesellschaften grundlegend wurden, zu Vektoren der Herrschaft von Männern über Frauen, während Frauen auf die Produktion von Nahrungsmitteln und die Reproduktion der Arbeitskraft verwiesen wurden.
Die Entscheidung von Pascal Picq und anderen ist, wie gesagt, eher eine soziale und politische als eine wissenschaftliche. Die Entscheidung, die wir treffen, ist ebenfalls eine solche, aber sie ist Teil des bewussten Kampfes der Menschheit, sich von allen Formen der Unterdrückung und Ausbeutung zu befreien. Erst mit der Jungsteinzeit wurde die Unterdrückung der Frau zu einer systematischen, allgemeinen Tatsache, indem sie unter dem Druck der Entwicklung der Produktivkräfte ihren Charakter änderte, wo „selbst im Haus der Mann das Ruder in die Hand nahm; die Frau wurde erniedrigt, versklavt, sie wurde Sklavin der Lust des Mannes und bloßes Instrument der Fortpflanzung“ [11], eine globale und entscheidende Veränderung für die Menschheit.
Diese Entscheidung, die das Herzstück des Marxismus ist, ermöglicht es, diejenigen politisch zu bewaffnen, die sich über die Unterdrückung der Frauen empören und nach einer Lösung suchen. Wenn man versteht, dass diese Unterdrückung ein Produkt der Entwicklung der Produktivkräfte auf einer Stufe ist, auf der die Anhäufung von Reichtum und Ausbeutung entstanden ist, versteht man, dass man mit einer solchen Unterdrückung nur Schluss machen kann, wenn man mit der Notwendigkeit der Anhäufung und Ausbeutung Schluss macht. Indem sie den Kapitalismus stürzt und die Wirtschaft weltweit rational organisiert, wird die Arbeiterklasse in der Lage sein, eine Welt zu errichten, in der jeder nach seinen Bedürfnissen erhält und nach seinen Fähigkeiten arbeitet, unabhängig von seinem Gesundheitszustand, eine Welt, in der kollektive Strukturen es Frauen ermöglichen, endgültig aus dem Haus zu kommen und voll am öffentlichen Leben teilzunehmen, eine Welt, in der Eheschließungen nicht nach wirtschaftlichen Zwängen erfolgen. Nur unter diesen Bedingungen kann die Gleichheit aller Menschen, einschließlich der Geschlechter, wirklich verwirklicht werden.
20. Juni 2023
[1] Pour la science Nr. 537, Juli 2022, Mappe S. 36-47; Pascal Picq, Et l'évolution créa la femme, Odile Jacob, 2020. [Und die Entwicklung schuf die Frau]
[2] Einleitung von 1891 zur Neuauflage von Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates
[3] Karl Marx und Friedrich Engels, Die deutsche Ideologie, 1845.
[4] Kommentare von Alain Testart zu seinem Buch Le communisme primitif, 1985.
[5] Alain Testart, Avant l'histoire, Gallimard, 2012.
[6] Ibid.
[7] Marx und Engels, Die deutsche Ideologie, 1845.
[8] Plechanow, The Development of the Monist View of History, Kapitel V, 1895.
[9] Amnesty International spricht von 5.000 einheimischen Völkern, die heute fast 500 Millionen Menschen repräsentieren, wobei die Definition von indigenen Völkern weit gefasst ist.
[10] Matriarchale Gesellschaften, erschienen bei Des femmes-Antoinette Fouque im Jahr 2019.
[11] Der Ursprung der Familie, Kapitel II.3